


Unsere äußere Welt erfahren wir über unsere Sinne. Wir tasten nach dem Ausschaltknopf des Weckers am Morgen, riechen den Kaffeegeruch in der Küche, hören die gut gelaunte Stimme des Morgenmoderators, schmecken die geröstete Weißbrotscheibe, sehen den großen Zeiger der Küchenuhr, unseren Lebenspartner, wie sie oder er zum Abschied lächelt und die Plakate an der Wand der Bahnhofshalle. Auf dem Bahnsteig weht der Wind. Wir bemerken seine Kühle und den Luftdruck auf unserer Haut und hören sein pfeifendes Geräusch. Von Ferne hören wir noch ein zweites: Der Zug kommt.
Durch unsere Augen sehen wir unsere Umwelt.
Tipp Schauen Sie für einen Moment ganz wach und entspannt durch Ihre Augen, ohne etwas zu fokussieren. Nehmen Sie bewusst Ihr gesamtes Gesichtsfeld wahr.
Unser Sehsinn ist ein Wunderwerk. Immer noch sind wir kaum in der Lage, unser Sehen durch Technik nachzubilden: Wir nehmen ein Gesichtsfeld von etwa 180 - 190° wahr, im gesamten Bild sehen wir geradlinige Objekte ohne Krümmung. Wir nehmen feine Farbnuancen wahr.
Beispiel Ein klarer Abendhimmel enthält fließende Farbübergänge von blau, hellblau, violett bis zu rot.
Unser Sehsinn bewältigt Gegenlicht leicht: Wir können in das Licht eines Fensters sehen und erkennen gleichzeitig die Struktur der Fensterrahmen.
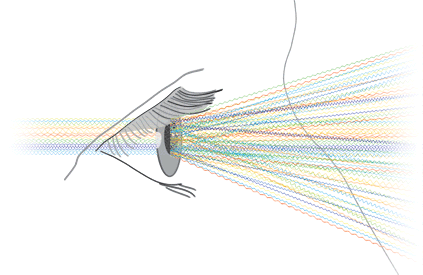 |
|
| Abb. 1-2 Sehen |
Unsere Linse filtert Streulicht heraus, sodass wir ein eindeutiges Bild unserer Umgebung wahrnehmen.
Wenn wir mit dem Fahrrad fahren, sehen wir den Weg vor uns ruhig, auch wenn der Boden nicht ganz eben ist. Würden wir mit einer Kamera, auf unserem Helm befestigt, dieselben Anblicke aufnehmen, so wäre das Video verwackelt.
Mit intaktem Sehsinn erkennen wir in der Entfernung die Preise an der Tankstelle sowie die Beine und Zangen einer winzigen Zecke auf der Haut eines Kindes. Wir können auch bei schwachem Mondlicht noch den Weg im Nadelwald sehen und wenn wir die flach stehende Abendsonne betrachten, sehen wir dennoch den umgebenden Himmel und die Wolken, wie sie von der Sonne angestrahlt werden.
Unser Sehen ist das Wahrnehmen von eintreffenden Lichtwellen. Diese werden in einem chemischen Prozess in elektrische Impuls verarbeitet und im Gehirn ausgewertet.
Lichtquellen, wie die Sonne und Glühbirnen, senden zumeist überwiegend weißes Licht aus, welches alle Anteile unseres sichtbaren Spektrums enthält. Dieses weiße Licht reflektiert an den Oberflächen der uns umgebenden Objekte, wobei Spektralanteile verschluckt werden. Dieser reduzierte Lichtstrahl trifft auf unsere Netzhaut und wird dort als Farbpunkt wahrgenomen. Die Vielzahl der eintreffenden Lichtstrahlen und damit Farbpunkte auf unserer Netzhaut ergibt in jedem Moment ein Bild unserer Umwelt, siehe auch Anhang A1-1 Elementarsinne.
Das Wesen des Lichts beschreibt unsere Wissenschaft in Theorien, die bis heute im Wandel sind: Licht ist gleichzeitig Welle und Teilchen. Sicher ist, dass Licht auch durch das Weltall zu uns gelangt. Beim Schall ist dieses nicht der Fall.
Farbe ist eine Sinnesempfindung. Wir alle sehen grünes Gras, doch wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass anderen Lebewesen es ebenso grün sehen, geschweige denn, dass Gras grün ist. Jede von uns gesehene Farbe entsteht erst in unserem Gesichtssinn.
Schall ist eine Welle, wie das Licht auch. Ein tönender Lautsprecher oder unsere Stimme sind Schallquellen. Durch die schwingende Bewegung der Membrane oder unserer Stimmbänder werden die nahen Luftmoleküle angeregt und diese wiederum regen weiter benachbarte an. Eine Druckwelle entsteht, die unsere Ohren erreicht.
Lichtquellen sind rar im Vergleich zu Schallquellen, denn alle, von Luft umgebende, bewegte Materie gibt Schall ab.
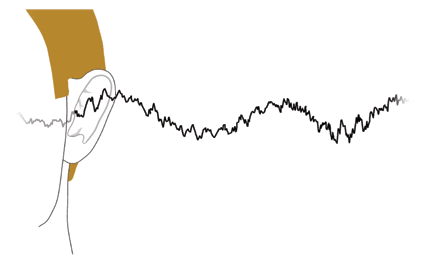 |
|
| Abb. 1-3 Hören |
Mit intaktem Hörsinn hören wir den Wasserhahn im Bad tropfen und ein Telefon im Nachbarhaus klingeln. Wir hören die Luft, die wir durch unsere Nase ein- und ausziehen sowie das Brummen des Kühlschranks in der Küche. Wir hören die Stimmen unserer Mitmenschen, den Lüfter und die Festplatte des Laptops, den Wind, der um das Haus weht, die Autos auf der Straße und das Grummeln des Magens, wenn wir Hunger haben.
Schall ist die fortgesetzte Schwingung der uns umgebenden Moleküle und vollständig beschrieben durch die Geschwindigkeit, mit der er sich fortpflanzt sowie die momentane Amplitude, mit der die unmittelbar an unserem Trommelfell befindlichen Moleküle ausgelenkt sind.
Wenn wir einer Schallwelle eine Weile zuhören oder diese aufzeichnen, so erkennen wir das Frequenzspektrum, das Feld der mit der Welle übertragenen Frequenzen, welches sich, in der Regel, in jedem Moment ändert.
Schall benötigt Materieteilchen zur Fortpflanzung, weshalb es im Vakuum des Weltalls keinen Schall geben kann.
In unserem Mittel- und Innenohr wird der eintreffende Schall zunächst in eine mechanische Schwingung und dann in ein Signal aus elektrischen Impulsen gewandelt, welches von unserem Gehirn ausgewertet wird, siehe auch Anhang A1-1 Elementarsinne.
Wenn wir einatmen, ziehen wir einen Luftstrom durch unsere Nasenhöhle hinunter in unsere Lunge.
Luft besteht zu etwa 99% aus Stickstoff und Sauerstoff und 1% aus sonstigen Molekülen. Geruchsquellen sind z. B. eine Tasse Kaffee, eine Frühlingswiese, das Parfum einer Dame im Vorbeilaufen, Autoabgase, Hundekot oder ein Stück frisch gesägtes Holz. Geruchsquellen sondern Moleküle ab, die sich mit der Luft vermengen und von dieser fortgetragen werden. Unser Riechorgan registriert diese und deren Menge.
Wir riechen in jedem Moment. Wollen wir einen Geruch bewusst und detailliert wahrnehmen, schnuppern wir.
Test Atmen Sie wie gewohnt ein und verfolgen Sie den Luftstrom. Achten Sie auf den Weg, den dieser durch Ihre Nase nimmt.
Atmen Sie nun schnuppernd ein.
Beim Schnuppern geht der eingeatmete Luftstrom einen anderen Weg als beim unbewussten Einatmen: Wir ziehen die Luft höher in unseren Riechspalt. Oben im Riechspalt sitzen die Sinneshärchen der Riechschleimhaut, die die einströmenden Geruchsmoleküle und damit einen Geruchsreiz aufnehmen und entsprechende Signale an unser Riechhirn senden. Aus der Kombination der vielen gleichzeitig eingehenden Impulse entsteht im Gehirn der Eindruck eines Geruchs.
Mit unserem Geruchssinn erkennen wir z. B. verdorbene Lebensmittel und Rauchentwicklung.
Beispiel 2 Jemand nimmt den Apfelsaft aus dem Kühlschrank. Das Tetra-Pack ist verschlossen, jedoch bereits angebrochen. Das Haltbarkeitsdatum läuft erst eineinhalb Jahren ab. Sie oder er öffnet den Plastikverschluss, drückt die Packung etwas und schnuppert die ausströmende Luft. Es riecht weder nach Schimmel noch vergoren.
Wir nennen solche Moleküle "Geruchsmoleküle", die auf unserer Riechschleimhaut eine Reaktion hervorrufen. Viele Moleküle und chemische Elemente, wie z. B. Sauerstoff, rufen keine Reaktion hervor und sind dadurch für uns geruchsneutral, siehe auch Anhang A1-1 Elementarsinne.
Auch unser Körper verströmt Moleküle, die Mitmenschen als Geruch identifizieren.
Anmerkung Manche Gerüche, wie z. B. Schimmel oder Kot, werten wir alle als unangenehm. Manche Gerüche, z. B. die, die ein Mitmensch verströmt, wirken auf den einen oder die eine anziehend, andere können den Menschen "nicht gut riechen".
Die Nahrung, die wir aufnehmen und auch andere Dinge, die wir unter Umständen in den Mund stecken, enthalten Geschmacksstoffe. Diese sind, wie Geruchsstoffe auch, gelöste Moleküle. Ein erwachsener Mensch hat etwa 2000 Geschmacksknospen im Mundraum, die auf spezielle Moleküle ansprechen. Die meisten Geschmacksknospen befinden sich am Rand unserer Zunge, weitere im Gaumen.
Im Wesentlichen können wir mit unserem Geschmackssinn nur die vier Grundgeschmäcke süß, salzig, sauer und bitter unterscheiden. Unsere Zungenspitze nimmt vornehmlich süß, die Seiten sauer und salzig und der Bereich vor dem Zungengrund Bitteres wahr. Auf molekularer Ebene findet jedoch auch noch eine differenziertere Geschmackswahrnehmung statt.
Auch beim Schmecken geben die Rezeptorzellen Impulse ab, die zum Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet werden.
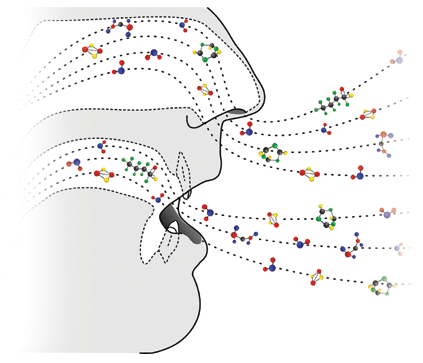 |
|
| Abb. 1-4 Riechen und Schmecken |
Als Kind durchleben wir eine Phase, in der wir alles uns Umgebende in den Mund stecken. Später reduzieren wir diese Auswahl an Dingen. Kaum ein Erwachsener probiert noch einen Löffel Regenwasser aus der Pfütze oder kaut den Sand an der Küste.
Test 2 Halten Sie sich beim Essen die Nase zu. Was schmecken Sie nun noch?
Der Geschmack einer Speise oder eines Getränks ist ein Zusammenspiel von Riechen und Schmecken. Ein Weinprüfer erkennt alleine an der Blume Art und Herkunft eines Weines.
Unser Riechen und Schmecken ist das Identifizieren von Molekülen, die wir einatmen und zu uns nehmen. Unser Riechen liefert dabei das feinere Ergebnis, unser Schmecken liefert alleinig die vier Grundgeschmäcke. "Salzig", z. B., können wir nicht riechen.
Unsere Haut ist ebenfalls ein Sinnesorgan. Unter ihrer Oberfläche liegen Tastsensoren, die an den Fingerspitzen so dicht sind, dass wir räumliche Details bis zu 0,5 mm auflösen können. Über feine Druckunterschiede nebeneinander liegender Abtastpunkte erkennen wir die Oberflächenbeschaffenheit eines Objekts oder Wesens. So ertasten wir z. B. spitz und scharf, rau und strukturiert, genoppt, geriffelt, samtig und pelzig. Anhand der Nachgiebigkeit erkennen wir Härte, Weichheit und Elastizität. Durch die gleichzeitigen Eindrücke vieler Finger erkennen wir die Form eines Gegenstandes mit geschlossenen Augen.
 |
|
| Abb. 1-5 Tasten |
Test 3 Rollen Sie eine Lychee zwischen Ihren Fingern und tasten Sie die harte Schale mit ihren pyramidenförmigen Ecken. Nichts fühlt sich so an wie eine Lychee. Pellen Sie nun die Frucht von der Spitze an. Bei manchen gelingt es, die trockene Zwischenhaut auf der Fruchtschicht zu belassen. Nehmen Sie eine derart gepellt in die eine und eine neue in die andere Hand. Schließen Sie die Augen und tasten Sie. Welch ein Unterschied! Entfernen Sie nun auch die trockene Haut bis Sie das feuchte Fruchtfleisch in Ihren Fingern halten.
Über die von der Haut weitergeleiteten Dehnungsreize erkennen wir Druck. Wir bemerken so z. B. die Beschleunigung im startenden Flugzeug, den Widerstand eines Türdrückers beim Öffnen und den Wind an der Bushaltestelle.
Der Wind ist auch kühlend. Neben Druck tasten wir auch Temperatur. Wir registrieren über unsere Haut die Temperatur der uns umgebenden Luft und von Gegenständen, die wir berühren oder die Wärme oder Kälte abstrahlen.
Test 4 Halten Sie einen Finger dicht über die Oberfläche eines Blumentopfs, ohne die Erde zu berühren.
Über unsere Haut an den Fingerspitzen registrieren wir, ob die Erde feucht ist.
An manchen Stellen unseres Körpers sind Tastsensoren besonders üppig: An den Fingern, den erogenen Zonen und im Mund. Ein kompletter Ausfall unseres
Tastsystems kommt von Natur aus nicht vor. Ohne wären wir kaum überlebensfähig. Sanfte Ganzkörpermassagen bewirken z. B. bei Frühgeborenen, dass diese weniger Stresshormone ausschütten, ruhiger schlafen und schneller zunehmen. [2; 3, siehe u. a. Artikel "Gefühlte Welten", Ausgabe Nr. 3/2004]
| 1.3.1 | Ich sehe, höre, rieche, schmecke und taste. |
Über unsere Sinne erfahren wir unsere äußere Welt. Ohne unsere Sinne wäre keine äußere Welt für uns existent. Wir würden das Frühstück weder sehen, schmecken noch riechen. Ohne unser Sehen und Tasten können wir nichts greifen oder halten. Wir könnten es nicht einmal verdauen, denn auch unser Magen und Darm reagieren auf Tastempfindungen.
In der Aufzählung unserer Sinne nennen wir zumeist das Sehen, gefolgt vom Hören. Auf beiden liegt in der heutigen Zeit eine hohe Aufmerksamkeit: Fernsehen, Computer, Radio, Zeitung, Bücher und Werbung (mit Ausnahme von Parfumproben) beliefern nur diese beiden ersten Sinne. Wir glauben zumeist, dass der Verlust von Riechen und Schmecken weniger schwerwiegend wäre als der von Sehen und Hören.
Mit "sinnlich" bezeichnen wir oftmals etwas Erregendes. Im Ursprung des Wortes bedeutet "sinnlich" jedoch nur, dass wir über unsere Sinne wahrnehmen. Barfußlaufen ist z. B. ein sinnliches Erleben, da unter unserer Fußsohle viele Nervenenden liegen.
Anmerkung Allein das Erfahren der Welt mit offenen Sinnen ist er- und anregend.
Anmerkung 3 Manch einer oder eine ist noch nie im Leben über die Steine der eigenen Auffahrt barfuß gelaufen.

|
| weiter |  |
|
 |
zurück | |
 |
Start Teil 1 | |
 |
Startseite |
